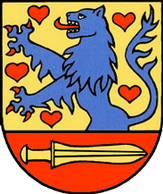Ortschronik (Zur Zeit in Überarbeitung)
Vorherige Druckversion
Stand: 18.02.2023
20.000 v.Chr.
Nacheiszeit
Der Grund auf dem Wilsche heute liegt entsteht vor etwa 20.000 Jahren. Nach der letzten Eiszeit transportieren die Schmelzwasser in den Urstromtälern (Aller, Ise) auch Unmengen von Sand. Als die Eisdecke verschwindet und das Flußwasser langsamer fließt, setzt sich der Sand an den Flußrändern ab (Talsand). In der späteren Nacheiszeit trocknen weite Flächen in den Urstromtälern aus. Der Sand wird durch Windstürme aufgewirbelt. Es bilden sich, genau wie an der Nord- und Ostsee, Dünen und Dünenketten. Auf diesen Dünen siedeln sich allmählich niedere Pflanzen an und die Landschaft wandelt sich durch sie in eine sumpfige, moorige Bruchlandschaft mit einem dichten Baumbestand aus Erlen, Eschen, Weiden, Birken und Kiefern. Durch die Dünenketten im Allerurstromtal ist es möglich, das Tal an einigen Stellen (die späteren Furten) zu überqueren. Die Kuppen der Dünen können wir noch heute in den Wäldern und Sandgruben rund um Wilsche entdecken.
500 vor Christus
Erste Ansiedlung
Es gibt Hinweise darauf, daß auf dem Gebiet der heutigen Ortschaft Wilsche bereits um 500 v.Chr. Menschen seßhaft sind. Zu dieser Zeit betreiben die Menschen einfache Formen der Landwirtschaft, leben vom Sammeln der Früchte und Samen, von der Jagd in den umliegenden Waldungen und vom Fischfang in der Ise und in der Aller. Sie wohnen in balkengestützten Holzhütten, deren Wände aus mit Lehm verflochtenen Zweigen bestehen. Ein Fernweg vom Harz kommend führt nach einer Allerfurt vermutlich durch diese Ansiedlung. Der Fernweg (später: „Sächsischer Fernweg“) verläuft durch Wilsche zum Westufer der Ise, von dort zur Ilmenau und führt bis zur Unterelbe.
785
Sachsenkrieg
Am Ende der Sachsenkriege Karls des Großen kommt es zur Niederlage der Sachsen und zur Taufe Herzog Widukinds. Die sächsischen Stammesgebiete werden in das Frankenreich integriert und in die Herrschaften Westfalen, Engern und Ostfalen aufgeteilt.
Wilsche liegt im Herrschaftsgebiet Ostfalen.
Wilsche liegt im Herrschaftsgebiet Ostfalen.
815
Christianisierung
Um die Christianisierung der Sachsen voranzutreiben, werden die Bistümer Hildesheim und Halberstadt eingerichtet. Die Oker bildet die Grenze.
Wilsche gehörte zum Bistum Hildesheim (Gifhorn zum Bistum Halberstadt).
Wilsche gehörte zum Bistum Hildesheim (Gifhorn zum Bistum Halberstadt).
1152
Erste urkundliche Erwähnung
Im Krönungsjahr des Deutschen Kaisers, Friedrich Barbarossa, findet sich in einer Hildesheimer Urkunde die erste schriftliche Erwähnung von Wilsche. Hierin ist zu erfahren, daß Lienmar (ein Lehnsmann Heinrich des Löwen) den Ort Bocla (Neubokel) sowie die Ortschaften Wilscethe (Wilsche), Ketelingen und Kästorf mit Ausnahme von sechs Hufen (1 Hufe = Land, das eine Bauersfamilie ernähren kann; etwa 20 ha) an das Hildesheimer Bistum (Bischof Bernhard von Hildesheim) verschenkt. Als Verpflichtung gilt, in Bokel ein vollständiges Kloster zu errichten in dem der zukünftige Abt dieselben Rechte und Verpflichtungen erhalten soll, wie die Hildesheimer Äbte in den Kirchen St. Michaelis und St. Godchardi.
1180
Zerschlagung des welfischen Gebietes
Über Heinrich den Löwen wird die Reichsacht verhängt, nachdem er sich geweigert hatte, Kaiser Barbarossa im Jahr 1176 in der Lombardei militärisch zu unterstützen. Seine Reichslehen werden eingezogen und sein Herzogtum wird in 40 Teilterritorien (Fürstentümer, Grafschaften) zerschlagen. Durch seine Unterwerfung bleiben seine Erbgüter Braunschweig und Lüneburg jedoch in welfischem Besitz.
Während der Verbannung Heinrich des Löwen gehört Wilsche zum Verwaltungsgebiet des Erzbischofs Philipp von Köln.
Während der Verbannung Heinrich des Löwen gehört Wilsche zum Verwaltungsgebiet des Erzbischofs Philipp von Köln.
1185
Zeit der Kreuzzüge
Heinrich der Löwe kehrt mit seiner Frau und dem Sohn, Heinrich der Ältere, nach Braunschweig zurück. Kaiser Barbarossa fordert ihn auf sich zu entscheiden, ob er an seinem Kreuzzug teilnehmen wolle, um dadurch seinen früheren Stand und seine Lehen zurückerhalten zu können, oder ob er stattdessen erneut ins Exil gehen wolle. Heinrich der Löwe entscheidet sich für das erneute Exil.
Wilsche verbleibt im Machtbereich des Erzbischof Philipp von Köln.
Wilsche verbleibt im Machtbereich des Erzbischof Philipp von Köln.
1189
Rückkehr Heinrich des Löwen
Die Gemahlin Heinrich des Löwen, Mathilde, stirbt in Braunschweig und er kehrt trotz der Exilverfügung nach Braunschweig zurück. Der Kaiser und seine wichtigsten Fürsten sind zur Reise ins Heilige Land aufgebrochen. Heinrich gelingt es in deren Abwesenheit große Teile seines ehemaligen Herrschaftsgebiets in Sachsen wieder einzunehmen. Kaiser Barbarossas Sohn, Heinrich VI., der während des Kreuzzuges die Regierung des Reiches innehat, führt ein Heeresaufgebot gegen Heinrich den Löwen ins Feld. Doch er muß nach dem Tod Wilhelms II. von Sizilien dort seine eigenen Erbansprüche sichern. Daher beendet er die Auseinandersetzung mit Heinrich dem Löwen und schließt mit ihm Frieden. Heinrich von Braunschweig, der älteste Sohn Heinrichs des Löwen, begleitete Heinrich VI. nach Italien.
Wilsche gehört weiterhin zum welfischen Besitz Heinrich des Löwen.
Wilsche gehört weiterhin zum welfischen Besitz Heinrich des Löwen.
1194
Frieden zwischen Staufern und Welfen
Auf dem Kreuzzug ertrinkt 1190 Kaiser Barbarossa in dem Fluß Saleph (heute: Göksu). Der Konflikt zwischen Welfen und Staufern wird durch die Eheschließung von Heinrichs des Löwen ältestem Sohn (Heinrich der Ältere mit Agnes von Staufen) endgültig beigelegt. Heinrich VI. schließt mit dem welfischen Herrscherhaus offiziell Frieden und Heinrich der Ältere wird mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein belehnt.
Wilsche gehört wieder zum welfischen Gesamtherzogtum.
Wilsche gehört wieder zum welfischen Gesamtherzogtum.
1203
Paderborner Vertrag
Nach dem Tod Heinrich des Löwen (1195) wird im Paderborner Vertrag der welfische Besitz zwischen Heinrichs Söhnen aufgeteilt. Heinrich erhält den westlichen Teil und einige Besitzungen im Norden. Das östliche Gebiet wird unter Otto und Wilhelm geteilt.
Wilsche gehört zum welfischen Gesamtherzogtum Herzogs Ottos.
Wilsche gehört zum welfischen Gesamtherzogtum Herzogs Ottos.
1213
Westfälische Herrschaft
Herzog Otto und Herzog Heinrich haben keine eigenen erbfähigen Nachkommen. Als der dritte Sohn Heinrich des Löwen, Wilhelm, im Jahr 1213 verstirbt ist dessen Sohn und Erbe, Otto I. (Otto das Kind), noch nicht regierungsmündig. Heinrich der Ältere übernimmt die Vormundschaft über seinen Neffen und Otto IV. übernimmt die Herrschaft über das Herzogtum Lüneburg.
Wilsche wird vom Rheinland aus regiert.
Wilsche wird vom Rheinland aus regiert.
1235
Gründung des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg
Da Otto I. der einzige erbberechtigte Nachkomme der Kinder Heinrich des Löwen ist, setzt Heinrich der Ältere seinen Neffen zum Erben aller welfischen Besitztümer ein. Nach Heinrichs Tod (1227) wird Otto I. auf dem Mainzer Hoftag mit dem neu gegründeten Herzogtum Braunschweig-Lüneburg belehnt.
Wilsche wird von Braunschweig aus regiert.
Wilsche wird von Braunschweig aus regiert.
1238
Schenkung an Herzog Otto
Herzog Otto vermehrt durch Kauf, Überlassung und Schenkung sein privates Eigentum. Abt Diedrich und der Convent St. Aegydii zu Braunschweig verkaufen dem Herzoge ihre Fischerei zu Gifhorn mit Waldung und Wiesen. Von den Grafen von Dassel läßt er sich ihr Eigentum in Wilsche schenken (vermutlich die in der Schenkungsurkunde Lienemars an den Hildesheimer Bischof ausgenommenen Hufen).
1248
Schenkung an das Kloster Isenhagen
Herzog Otto schenkt dem Kloster Isenhagen die Kirche zu Bockel und die dazugehörigen Höfe in Wilsche.
1265
Herzogliche Vogtei
In Gifhorn wird eine herzogliche Vogtei eingerichtet.
Wilsche fällt in die Verwaltungs- und Gerichtsbarkeit des Amtes (Hausvogtei) Gifhorn.
Wilsche fällt in die Verwaltungs- und Gerichtsbarkeit des Amtes (Hausvogtei) Gifhorn.
1269
2. Welfische Erbteilung
Im Rahmen der zweiten Erbteilung wird das welfische Herzogtum zwischen Albrecht dem Großen und Johann aufgeteilt. Albrecht fällt die Herrschaft Braunschweig mit Gifhorn zu.
Wilsche verbleibt im Machtbereich des Braunschweiger Welfenhauses.
Wilsche verbleibt im Machtbereich des Braunschweiger Welfenhauses.
1275
Marktrecht
Gifhorn wird das Marktrecht verliehen.
Die Wilscher Bauern erhalten das Recht, auf diesem Markt ihre Erzeugnisse zu verkaufen.
Die Wilscher Bauern erhalten das Recht, auf diesem Markt ihre Erzeugnisse zu verkaufen.
1370
Lüneburger Erbfolgekrieg
Nach dem Tod des erbenlosen Wilhelm II. von Lüneburg kommt es wegen Erbstreitigkeiten zwischen den Welfen und Kaiser Karl IV. zum „Lüneburger Erbfolgekrieg“. Der Krieg endet nach der Schlacht von Winsen mit einem Sieg der Welfen. Sie erhalten das Herzogtum Lüneburg vollständig zurück. Da in diesem Krieg die Lüneburger Welfenburg völlig zerstört wurde, wird Celle zur neuen Residenzstadt des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg.
Wilsche wird von Celle aus regiert.
Wilsche wird von Celle aus regiert.
1388
5. Erbteilung
In der 5. Welfischen Erbteilung wird das Erbe Herzog Magnus Torquatus zwischen seinen drei Söhnen aufgeteilt.
Wilsche wird von Wolfenbüttel aus regiert.
Wilsche wird von Wolfenbüttel aus regiert.
1428
Ländertausch
Nach dem Tod Herzog Heinrich I. kommt es zwischen seinen Nachkommen zu einem Ländertausch. Bernhard I. erhält das Fürstentum Lüneburg.
Wilsche wird von Celle aus regiert.
Wilsche wird von Celle aus regiert.
1489
Erstes Schatzregister
Naturalabgaben werden durch Geldabgaben ergänzt. Die durch einen „Schatzverordneten“ zu erhebenden Gelder (Steuern) werden für jeden abgabepflichtigen Hof in einem Schatzregister festgelegt und dokumentiert (z.B. Schafschatz: für jedes Schaf 12, für jedes Lamm 3 Pfennige).
Das erste Schatzregister von Wilsche führt nur 3 Hofstellen auf. Wahrscheinlich unterlagen nur diese als Vollhöfe der direkten Abgabepflicht gegenüber dem Landesherrn. In späteren Registern sind 7 Vollhöfe aufgeführt.
Das erste Schatzregister von Wilsche führt nur 3 Hofstellen auf. Wahrscheinlich unterlagen nur diese als Vollhöfe der direkten Abgabepflicht gegenüber dem Landesherrn. In späteren Registern sind 7 Vollhöfe aufgeführt.
1519
Hildesheimer Stiftsfehde
In der Hildesheimer Stiftsfehde (1519-1523) wurden in und um Gifhorn durch Kämpfe und Brandschatzung einzelne Häuser und Teile von Ansiedlungen zerstört, darunter auch die mittelalterliche Gifhorner Welfenburg und Gebäude in Wilsche.
1524
10. Welfische Erbteilung
In der 10. Welfischen Erbteilung der drei Söhne des Herzog Heinrich des Mittleren verzichtet Otto auf die Regentschaft und überläßt seinen beiden Brüder, Ernst dem Bekenner und dem (noch regierungsunmündigen) Franz das welfische Erbe.
1539
Protestantismus und Schloßbau
Franz erhält das neugegründete Herzogtum Gifhorn-Isenhagen. Er bekennt sich zum (protestantischen) Augsburger Bekenntnis und läßt das Gifhorner Schloß errichten. Es ist davon auszugehen, daß auch Einwohner von Wilsche am Bau mitgewirkt haben, da die Tagelöhner bei dem Schloßbau weit über dem üblichen Lohn bezahlt wurden.
1549
Tod des Herzog Franz
Herzog Franz verstirbt ohne Nachkommen das Herzogtum Braunschweig-Gifhorn fällt an seinen Bruder, Ernst den Bekenner.
Wilsche wird von Celle aus regiert.
Wilsche wird von Celle aus regiert.
1557
Braunschweiger Jagdgebiet
Herzog Franz-Otto schließt mit der Stadt Braunschweig einen Vertrag, in dem im Amt Gifhorn das Jagdrecht für die Bürger der Stadt Braunschweig festgeschrieben wird. Außer in der Zeit zwischen Ostern und Jacobi (15.08., Maria Himmelfahrt) dürfen Hühner und Hasen gefangen und erlegt werden. Die südlichen Wälder um Wilsche sind für die Stadtjäger freigegeben. Zum Erkennen der Jagdgrenzen werden „Mahlzeichen“ mit Steinen oder durch Erdaufwürfe geschaffen. Die nördlichen Waldungen (Ringelah) bleiben herzogliches Jagdgebiet.
1564
Sondersteuer (Viehschatz)
Der Landtag zu Celle beschließt zur Abdeckung der landesherrlichen Schulden einen fünfjährigen dreifachen Viehschatz (Steuern) zu erheben. Von den Einwohnern mussten jährlich etwa 36 Gulden zusätzlich erbracht werden (das entsprach damals etwa dem Kaufpreis für 4 Pferde / heute etwa 8000 €).
1566
Türkensteuer
Die Bedrohung des Reiches durch die Türken erfordern erhebliche Gelder für die Anwerbung und Ausrüstung von Söldnern und für die Durchführung des Krieges. Von den Haus- und Grundbesitzern in Wilsche müssen 76 Gulden als „Türkensteuer“ erbracht werden.
1580
Erste Brinksitzer
Brinksitzer gehörten zur 3. Bauernschicht. Sie besitzen am Rande des Dorfes Wilsche kleine Häuser und nur wenig eigenes Land. Der eigene landwirtschaftliche Besitz reicht nicht zum Lebensunterhalt aus. Sie haben kein Recht, ihre landwirtschaftlichen Produkte auf dem Markt zu verkaufen. Die Brinksitzer sind gezwungen, sich als Kleinhandwerker, Dienstboten, Tagelöhner, Schulmeister oder Hirten zusätzlichen Unterhalt zu verdienen. In der Höfeliste des Amtes Gifhorn sind erstmalig vier Brinksitzerstellen zu finden.
1590
Hitzejahr
Aus der Braunschweig-Lüneburgischen Chronica erfahren wir von der Heimfahrt der Königin von „Dennenmarck“ (29. Juni). Sie war zu Besuch bei Herzog Heinrich Julius und ihrer Tochter in Wolfenbüttel. Aufgrund der großen Hitze sind auf ihrer Reise vierundzwanzig Mitreisende „theils erstickt, theils von den geschwinde trincken gestorben und im Wasser ertruncken, ohne diejenigen, so kranck worden“.
In Gifhorn ist ein Edelknabe der dänischen Königin mit goldenen Ketten und 300 Gulden verschwunden. Er soll zuletzt auf dem Weg nach Wilsche gesehen worden sein.
Wie alle männlichen Bürger im Amt Gifhorn müssen auch die Wilscher Männer im Kriegsfall Dienst leisten und die Kriegsausrüstung selber bereitstellen. Die Bauern der 1. Bauernschicht (Vollhöfe) müssen zu Pferde dienen.
In Gifhorn ist ein Edelknabe der dänischen Königin mit goldenen Ketten und 300 Gulden verschwunden. Er soll zuletzt auf dem Weg nach Wilsche gesehen worden sein.
Wie alle männlichen Bürger im Amt Gifhorn müssen auch die Wilscher Männer im Kriegsfall Dienst leisten und die Kriegsausrüstung selber bereitstellen. Die Bauern der 1. Bauernschicht (Vollhöfe) müssen zu Pferde dienen.
Ab 1590 in Überarbeitung
1632
Lehrer
Der Wilscher Florian Ramme wird als erster Lehrer erwähnt. Er unterrichtete in Gamsen und Kästorf. 1662 wird in den Kirchenbüchern Heinrich Kahlen als Wilscher Lehrer genannt. Sein Nachfolger wird 1669 der Gifhorner Leinewebersohn Hartwig Flohr, der 1716 von seinem Sohn Hartwig Christian abgelöst wird.
1640
Post
Während des 30 jährigen Krieges wird durch die Schweden die erste Post in Gifhorn eingerichtet (heute: „Deutschen Haus“). Eine Poststraße führte von Gifhorn über Wilsche und Müden nach Celle
1735
Erster Schulbau
In dem Schulneubau befanden sich die Schulstube, eine kleine Stube und zwei Kammern. Daneben gab es einen Schaf- und einen Schweinestall. Die Schulstube für die Kinder war gleichzeitig auch die Wohnstube der Lehrerfamilie. Um den Schulraum zu heizen, wurde jedem Vollmeier, Köther und Brinksitzer (insgesamt 14 Hofbesitzer), jähr lich ein Fuder Torf angefahren.
1765
Anbauernstellen
Anbauer gehörten zur 4. Schicht von Hofbesitzern in Wilsche. Sie waren Landpächter mit einer kleinen eigenen Hofstelle, Anbauern besaßen ein erbliches Nutzungsrecht an den Gemeinheiten (ländlichen Flächen und Einrichtungen der Gemeinde [Almende]). Hans-Jürgen Laue richtet die erste Anbauernstelle ein (heute der "Fährmannsche Hof"). Kurz darauf entstehen die heutigen Stellen Berg-Tietge und Brandes. Die vierte Stelle, heute Bock, wird eine Generation später gegründet.
1792
Verkopplung
König Georg der III residiert in London als König von Groß-Britannien und als Kurfürst und erst 1814 auch als König. von Hannover. Wegen seines Gesundheitszustandes und der Abwesenheit von Hannover setzt er dort Beamte für die Verwaltung ein. Diese erkennen, dass eine erfolgreiche Landwirtschaft ohne Verkopplung und Befreiung von der Lehnsherrschaft nicht möglich ist. Die Wilscher wehren sich zunächst gegen diese Reform, die aber um 1840 eingeleitet und 1860 abgeschlossen wird. Die gesamte Struktur der Felder, Straßen Wege und Vorflutgräben ist damals entstanden. Die Landwirtschaft nimmt in der folgenden Zeit einen großen Aufschwung. Für das Rindvieh wird die Stallhaltung eingeführt. Schafe und Schweine werden aber noch einige Zeit gemeinschaftlich gehütet.
1855
Abbauernstellen
Abbauern gehören zu 5. Schicht von Hofbesitzern in Wilsche. Sie waren Pächter (Neusiedler) mit einem kleinen Eigenbesitz. Sie hatten kein Nutzungsrecht an den gemeinsamen ländlichen Flächen und Einrichtungen der Gemeinde (Wiesen, Weiden, Tränken oder sonstige landwirtschaftliche Einrichtungen). Abbauern waren keine Gemeindemitglieder und konnten die Gemeindeangehörigkeit auch nicht erwerben. Die Abbauerstellen und viele Hofstellen der heutigen Mühlenstraße und des Hahnenberg werden in dieser Zeit gegründet. Die Einwohnerzahl steigt von 1802 - 1848 von 174 auf 245.
1868
Aufteilung der Gemeinheiten (Almende)
Der Grund für die Beendigung der gemeinsamen Nutzung von Gemeinheiten (ländlichen Flächen und Einrichtungen der Gemeinde) war der schlechte Zustand der übernutzten und von niemandem gepflegten Weidegründe und Holzungen. Dazu kam der Landhunger der Brinksitzer und der An- und Abbauern. Bevor jedoch die Gemeinheiten einer Ortschaft unter den Berechtigten Bauern aufgeteilt werden konnten, mußten die Grenzen zu den benachbarten Gemeinden festgelegt werden. Bisher trieben die Hirten ihre Herden nach Jahrhunderte altem Gewohnheitsrecht weit in die Heiden und Moore und trafen dort (gelegentlich mit körperlichen Auseinandersetzung) mit den Hirten anderer Gemeinden aufeinander. Bei der Aufteilung der Wilscher Gemeinheiten im Jahre 1868 erhielt auch die Schule einen Anteil der bisherigen Gemeinheiten. Ende des 19 Jahrhunderts gehörten insgesamt 21,68 ha Ackerland und Wiese, davon 16,3 ha unkultiviert, dazu und konnten vom Inhaber der Lehrerstelle bewirtschaftet werden.
1870
Errichtung einer Windmühle
Eine 1705 im Kreis Gardelegen erbaute Windmühle wird vom Müller Carl Horst aus Dieckhorst erworben und nach Wilsche umgesetzt.